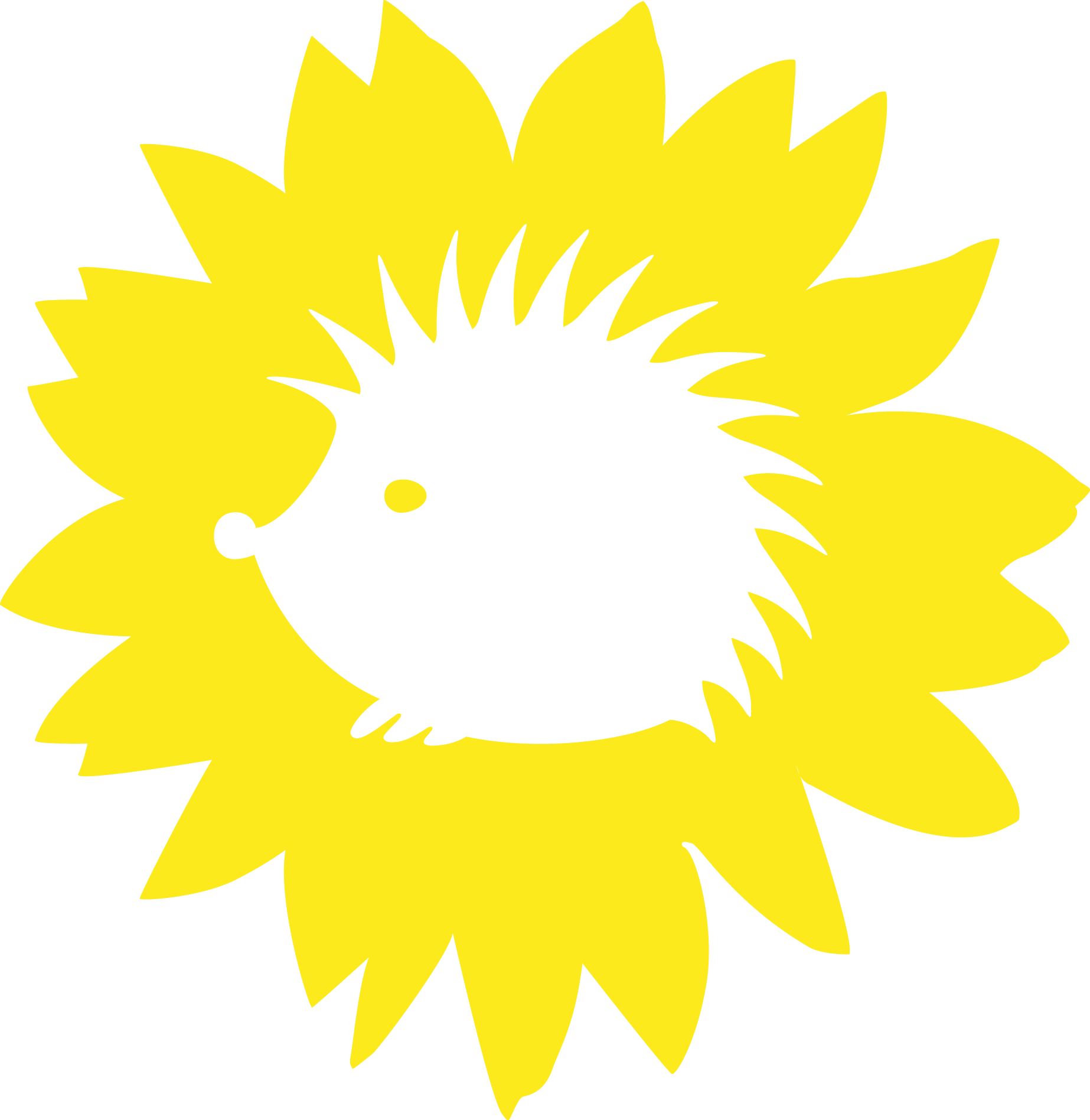Podiumsdiskussion „Ankommen (un)möglich? Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine auf der Flucht“
Am 9. Dezember 2022 waren Vertreter*innen aus der Verwaltung, aus verschiedener Verbänden und ehrenamtlichen Initiativen sowie geflüchtete Menschen aus der Ukraine der Einladung von Catrin Wahlen zur Podiumsdiskussion gefolgt. Das Thema war die aktuelle Situation bei der Bedarfsidentifizierung, Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine.
Im Publikum saßen Vertreter*innen aus Vitsche e.V., Fight for Right!, AWO Berlin e.V., DRK e.V., Kharkiv Blind Lawyers, Bundeskontaktstelle für Geflüchtete mit Behinderung und/oder Pflegebedarf, Cooperative Mensch e.V., Sunflower Care e.V., “Kiek in – Soziale Dienste gGmbH”, Die Sputniks e.V., Berlin Arrival Support, Zentrum Liberale Moderne (LibMod), Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen, Berlin hilft e.V., Moabit hilft e.V., Mina e.V., Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, und viele andere.
Die gesamte Videoaufnahme der Veranstaltung findet Sie beim Youtube-Kanal von Catrin Wahlen unter dem folgenden Link: Podiumsdiskussion 9.12.22
Der Bericht auf Russisch sowie die Videoaufnahme auf Ukrainisch sind ebenfalls online abrufbar: Podiumsdiskussion 9.12.22 auf Russisch/Ukrainisch

Fraktionsvorsitzende Silke Gebel betont einleitend, das Thema dürfe „nicht hinten runter fallen“. Dafür brauche man Strukturen, um die Verwaltung und die Träger bei der Bewältigung der Herausforderungen, die aus der Fluchtbewegung entstehen, besser zu unterstützen. Gebel verweist auf die Forderung der Behindertenbewegung „nichts über uns ohne uns“. Nur gemeinsam mit allen Akteuren und insbesondere mit geflüchteten Menschen könne man den individuellen Belangen von Menschen mit Behinderungen auf der Flucht gerecht werden.
Catrin Wahlen, Sprecherin für Inklusion und Senior*innen der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus (AGH), unterstreicht in ihrer Begrüßung das zivilgesellschaftliche Engagement bei der Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Mit dem Fachgespräch möchte sie den Raum für Dialog zwischen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft öffnen. Sie verweist ebenfalls auf die Vernetzungskonferenz: Was können wir aus der Aufnahme geflüchteter Menschen mit Behinderung aus der Ukraine für die Inklusion geflüchteter Menschen in Deutschland lernen? vom 6.12.22. Die Konferenz wurde von der NGO Handicap International organisiert, die sich für die bedarfsgerechte Versorgung aller geflüchteter Menschen einsetzt.
Auf dem Podium begrüßte Catrin Wahlen:

- Olexander Nikulin, Aktivist der NGO „Fight for Right!“,
- Jian Omar, MdA, Sprecher für Flucht (Bündnis 90/Die Grünen)
- Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament,
- Michael Hilbold, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, sowie
- Tatjana Grabienski, Projektleiterin „Auf Achse in Treptow-Köpenick“ (Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben BZSL e.V.)

Olexander Nikulin erläutert, die Arbeit von „Fight for Right!“ habe sich seit dem russischen Angriffskrieg dahingehend verändert, dass nun die Evakuierung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund stehe, insbesondere die medizinische Evakuierung. Eine Woche vor dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 hat die Organisation hat eine Hotline für die Zielgruppe eingerichtet und steht seitdem für humanitäre Fragen und Rechtshilfe zur Verfügung. Allerdings hat der Krieg nicht erst am 24. Februar angefangen, sondern bereits vor über acht Jahren, so Nikulin. Der ukrainische Staat hat in dieser Zeit keine Pläne entwickelt, wie man Menschen mit Behinderungen im Notfall evakuiert. Diese Aufgaben haben ehrenamtliche Initiativen und NGOs wie Fight for Right! übernommen, wie z.B. die Evakuierung von Kindern, die an Beatmungsgeräten angeschlossen sind.
Und natürlich geht der Einsatz für Menschenrechte weiter, z.B. in Form von Seminaren und Weiterbildungen. Ein wichtiges Anliegen von Fight for Right! sei immer schon gewesen darauf hinzuweisen, dass es sich bei Menschen mit Behinderungen nicht um eine „graue Masse“ handle, sondern um vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft, die arbeiten und unser Land verändern können. Die Flucht beschreibt Nikulin für behinderte Menschen als besonders herausfordernd und langwierig, wie er selbst erlebt hat. Insbesondere für Menschen mit nicht-sichtbaren Beeinträchtigungen müssen sich ständig rechtfertigen, warum sie das Land verlassen wollen. Er äußert aber auch die Hoffnung, nicht ein Leben lang die Unterstützung in einem fremden Land in Anspruch nehmen zu müssen.
Erik Marquardt stellt die europäische Sicht auf Flucht und Migration in den Mittelpunkt. Dass 2022 über fünf Millionen geflüchtete Menschen in Europa aufgenommen werden, war für niemanden vorhersehbar. Er betont die Besonderheit der gegenwärtigen Situation und widmet sich der Frage, wie die Verteilung der geflüchteten Menschen in Europa abläuft. Zentral sei dabei, wie man es schaffe, die universellen Menschenrechte für alle geflüchteten Menschen zu achten und – daraus ableitend – die individuellen Bedürfnisse und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund“ zu rücken.

Angesichts der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, die nach Europa gekommen ist, habe die EU die Situation verhältnismäßig gut hinbekommen, nicht zuletzt dank dem zivilgesellschaftlichen Engagement. Es heißt aber nicht, dass alles gut läuft, deswegen seien die Veranstaltungen wie diese Podiumsdiskussion so wichtig. Zugleich betont Marquardt das hohe Engagement des Landes Berlin bei der Aufnahme geflüchteter Menschen. Wäre Berlin ein eigener Staat, wäre dieser unter den Top-10 der Aufnahmeländer. Die enorme Zahl von geflüchteten Menschen, die Berlin aufgenommen hat, bringt Herausforderungen für die Infrastruktur wie beispielsweise bei der Unterbringung, medizinischen Versorgung, beim Zugang zu Schule und Kitas, die wiederum für die Menschen auf der Flucht das Ankommen erschwert.
Gleichzeitig berichtet Erik Marquardt, dass er im Europäischen Parlament einen Rechtsruck bei den Vertreter*innen konservativer Parteien wahrnimmt. Das Thema werde für einen Meinungskampf missbraucht, bei dem man nicht mehr über die realen Herausforderungen spricht. Dass eine gesicherte Datengrundlage fehlt, erschwert die Diskussion zusätzlich. Es läuft zwar eine Studie vom Bundesinnenministerium zur Lage von geflüchteten Menschen mit Behinderungen. Die Ergebnisse werden erst Ende 2024 präsentiert. Ohne eine solide Datengrundlage könne man jedoch „keine gute Politik machen“. Marquardt fasst zusammen, dass es auf der EU-Ebene „keine geschlossene Strategie“ im Umgang mit dem Thema Flucht und Behinderung gäbe.

Von der Arbeit im Projekt „Auf Achse in Treptow-Köpenick“, in dem sie und ihre Kolleg*innen aufsuchende Beratung anbieten, berichtet Tatjana Grabienski vom Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben BZSL e.V. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist „aufsuchende Beratung für chronisch kranke und behinderte Geflüchtete“. Die Projektmitarbeiter*innen stellen auch die besondere Schutzbedürftigkeit der Menschen fest. Die derzeitige Arbeit wird dadurch erschwert, dass das Team noch mit den „Altfällen“ beschäftigt sei. Damit gemeint ist die Beratung von und Bedarfsfeststellung bei Menschen, die in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland geflüchtet sind und „multikausale Problemlagen haben“.
Grabienski stellt fest, dass die Gesundheitsinfrastruktur und die Sozialdienste überbelastet sind und es an einfachsten Hilfen wie beispielsweise der Sprachmittlung fehlt. Sie äußert den Wunsch nach zwei bis vier Einrichtungen für besonders schutzbedürftige Menschen in Berlin, wo man die Bedarfe erkennen und danach handeln könne, weil eine fehlende Behandlung tödlich sein kann. „Hilfe ist hier sehr langwierig,“ so Grabienski.
Jian Omar sieht in der gegenwärtigen Situation Parallelen zum Fluchtgeschehen in Folge des Syrienkriegs. Ein schnelleres Ankommen müsse ermöglicht werden. In sechs Monaten seien bereits mehr Menschen untergebracht worden als in den Jahren 2015 und 2016. Vor allem sei es wichtig, Teilhabe zu ermöglichen. Jian Omar betont die Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements, das Politik und Verwaltung entlastet. Das Jahr 2022 hat uns gezeigt, dass die Zivilgesellschaft agiler und schneller auf die unvorhersehbaren Ereignisse wie Krieg und Flucht reagieren kann. Mit ihrer großen Präsenz von Anfang an hat die Zivilgesellschaft wesentlich dazu beigetragen, die Herausforderungen infolge der seit dem zweiten Weltkrieg größten Fluchtbewegung zu bewältigen.

Allerdings müsse gerade die Politik darauf vorbereitet sein, dass die Fluchtbewegung infolge von verbrecherischen russischen Angriffen auf die Infrastruktur in der Ukraine zunehmen wird.

Michael Hilbold, derzeit bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit, Soziales tätig, berichtet von seiner früheren Erfahrung als Abteilungsleiter beim LAF im Referat 3, das sich mit der strategischen Entwicklung, Qualitätssicherung und Bedarfsprognose für Berlin befasst hat.
Er hat den Übergang vom LAGESO zum LAF mitgestaltet und seit 2020 die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Berlin begleitet. Seit dem Kriegsbeginn im Februar 2022 besteht seine Hauptaufgabe darin, Rahmenbedingungen zu erarbeiten, um die besonderen Schutzbedarfe von geflüchteten Menschen zu identifizieren und zu gewährleisten.
Herr Hilbold erläutert unterschiedliche Zugänge zur Leistungsversorgung für geflüchtete Menschen: entweder als Asylsuchende oder nach der so genannten „Massenzustrom-Richtlinie“. Im letzteren Fall gelten die Regelungen für die Eingliederungshilfe für Ausländer*innen (§100 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – SGB IX). Hierfür sind die kommunalen Bezirksämter zuständig, was jedoch eine „extreme Spreizung in der Leistungsgewährung und in der Leistungsanerkennung zufolge hat“. Außerdem gibt es für die Durchführung der Bestimmungen im Falle der Eingliederungshilfe noch keine bundeseinheitliche Regelung. Hilbold betont, dass der SenIAS eindeutig für die Möglichkeit plädiert, dass der Ermessensansatz geltend gemacht werden soll. Für die geflüchteten Menschen im Asylverfahren wiederum sei das LAF zuständig, was laut Hilbold „eine bessere Steuerung in der Leistungsgewährung ermöglicht“. Die Grundlage dafür bildet § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für beide Gruppen gilt, dass der Zugang zum Leistungssystem für geflüchtete Menschen mit einer „höhen Hürde“ verbunden sei. Die Zahl der Personen, die ihre Ansprüche in den letzten Jahren geltend gemacht haben, ist „verschwindend gering“.
Hilbold betont weiterhin, dass ohne die Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft das Land Berlin nicht in der Lage gewesen wäre, die bisherigen Herausforderungen in Folge des russischen Angriffkrieges auf die Ukraine zu bewältigen. Die Zivilgesellschaft ist am Anfang „für eine überforderte Verwaltung eingesprungen“. Der ehrenamtliche Einsatz hat dem Land Berlin geholfen, in der Zwischenzeit Strukturen aufzubauen, wie z.B. die Welcome Hall am Hauptbahnhof, wo die erste „Spezifizierung der Bedarfe erfolgen kann“. Hilbold hebt hervor, wie wichtig eine gute Bedarfsfeststellung sei. Da gibt es jedoch noch erheblichen Verbesserungspotential.

Die Welcome Hall empfielt Hilbold als „die erste Anlaufstelle [für neu ankommende Menschen], wenn es um Menschen mit Behinderungen oder anderen speziellen Bedarfen geht“. Das weitere Vorgehen hängt stark davon ab, für welchen Weg sich die geflüchteten Menschen entscheiden. So sind seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind ca. 354.000 Menschen in Berlin angekommen. Davon sind nur 67.800 zu einer Registrierungsvorsprache in Tegel gegangen. Alle anderen haben sich freiwillig entschieden, einen anderen Zielort anzustreben, darunter auch Menschen mit sichtbaren Beeinträchtigungen, die in der Welcome Hall gewesen waren. Diejenigen, die sich für die Registrierung in Tegel entschieden haben, werden entsprechend den Informationen aus der Welcome Hall bezüglich ihrer Bedarfe erwartet. Dies funktioniert jedoch „Mal gut und Mal weniger gut“, was laut Hilbold kein Dauerzustand sein darf.
Hilbold hat die Erfahrung gemacht, dass geflüchtete Menschen in einigen Fällen ihre Behinderung nicht angeben wollen, aus persönlichen Gründen, weil sie z.B. Diskriminierungserfahrungen in ihren Herkunftsländern gemacht haben. Außerdem kennen die geflüchteten Menschen ihre Leistungsansprüche und die Rechtsgrundlage in Deutschland nicht. Laut Hilbold gibt es in der Ukraine „kein Pflegesystem“, so dass Menschen auch hier keine Pflegebedarfe anmelden. Weiterhin verweigern sich die meisten Familien, ihre Angehörigen in die Pflegeeinrichtungen abzugeben, was Herr Hilbold als „kulturell bedingt“ sieht. Diese Erfahrungen müsse man berücksichtigen, wenn man eine „bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen“ möchte.
Als nächstes kommt das aktuelle Verteilsystem zur Sprache. Im April 2022 haben sich die Bundesländer darauf verständigt, ein Sonderverfahren für geflüchtete Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarfen ins Leben zu rufen, berichtet Hilbold. Das betrifft alle Menschen, die in Gruppen größer als neun Personen evaluiert und in den Drehkreuzen Berlin, Hannover und Cottbus ankommen. Berlin bleibt dabei Hauptankunftsort. NGOs und ehrenamtliche Initiativen bekommen im Zuge dessen die Möglichkeit, die von ihnen evakuierten Menschen direkt in diese Drehkreuze zu bringen. Damit es gut funktioniert, müssen Leistungsbedarfe erhoben und an die Bundeskontaktstelle bzw. an die Landeskoordinierungsstellen weitergeleitet werden, die wiederum den entsprechenden Drehkreuz vor der Ankunft der evakuierten Gruppe informieren. Dies soll dazu dienen, die notwendigen Vorbereitungen zur Versorgung der Gruppe im Vorfeld zu treffen. In Kopplung mit der Bundeskontaktstelle werden anschließend Plätze im Bundesgebiet für diese Personen bedarfsgerecht gesucht. Das beschriebene Verfahren ist laut Hilbold die Zielsetzung, die er „ohne Einschränkung“ unterstützt. In der Praxis stößt dieses Verfahren an die Grenzen, u.a. weil die Meldung der freien Plätze für die Bundesländer freiwillig erfolgt. Als Folge variiert die Bereitschaft der Landeskoordinierungsstellen stark, die Aufnahme von geflüchteten Menschen mit Behinderungen zu steuern. Gleichzeitig sieht Hilbold die Bedarfsermittlung der betroffenen Personen als Grundlage für die Weiterverteilung als richtig.
Für individuell einreisende Menschen mit Behinderung beschreibt Hilbold folgendes Problem. Die momentanen Verteilsysteme lassen sowohl in der „Massenzustrom-Richtlinie“ (im Ukraine-Ankunftszentrum Tegel) als auch für Asylsuchende (im Ankunftszentrum in Reinickendorf) keine Möglichkeit, die erhobenen Bedarfe in irgendeiner Form zu hinterlegen und bei der Verteilung zu berücksichtigen. Die geflüchteten Menschen bekommen im besten Fall ein Zettel mit den festgestellten Bedarfen in die Hand. Bei der Weiterverteilung wird nicht berücksichtigt, ob die notwendigen Versorgungsstrukturen vor Ort vorhanden sind. Dies ist ein „sehr von Personen abhängiges System“. An einem einheitlichen Prozess werde derzeit noch gearbeitet mit dem Ziel, die erhobenen Bedarfe im System zu hinterlegen und freizuschalten. Die Bundesländer haben es in einer Abstimmung bisher gemeinsam verhindert, so Hilbold.
Außerdem verweist Hilbold auf den Senatsbeschluss vom 5.04.2022, der den Senat „zu Schaffung von Strukturen für besonders schutzbedürftige [geflüchtete] Menschen“ auffordert. Daraufhin wurde innerhalb der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Ziel, Versorgungsstrukturen für geflüchtete Menschen mit Pflegebedarfen und Behinderungen aufzubauen, dessen Leitung Hilbold übernommen hat. Die Projektzielsetzung besteht aus drei Hauptpunkten: (1) systematische Identifikation und Bedarfsfeststellung von geflüchteten Menschen mit besonderen Schutzbedarfen (Screening); (2) die bedarfsgerechte Leistungsversorgung; (3) eine zentrale Anlaufstelle für alle geflüchteten Menschen mit Behinderungen in Berlin.
Im Folgenden werden diese drei Ziele erläutert. Momentan besteht für geflüchtete Menschen in Tegel die Möglichkeit zur Selbstangabe von Bedarfen, auch in Piktogramm-Form, was Hilbold für nicht sehr „valide“ hält, weil Menschen oft aus persönlichen Gründen diese Angaben nicht machen wollen. Auch die Augenscheinnahme ist laut Hilbold nur bedingt hilfreich, weil sie nur für die Feststellung von sichtbaren Bedarfen geeignet ist. Was die Leistungsversorgung angeht, übernehmen momentan die mobilen Beratungen diese Aufgabe, von denen Tatjana Grabienski bereits berichtet hat. Die bestehenden Angebote unterscheiden sich jedoch stark von denen in den Herkunftsländern, was zu Missverständnissen und teilweise zum Misstrauen führe, nicht zuletzt weil die Familie die Versorgung des Familienmitgliedes mit Behinderung als eigene Aufgabe sehe, so Hilbold. Deswegen plädiert er für neue Versorgungsmodelle, die die gesamten Bedarfsgemeinschaften und ihre bisherigen Aufgaben in den Blick nehmen.
Hilbold begründet die Notwendigkeit einer zentralen Anlaufstelle damit, dass momentan die zwölf Berliner Bezirke diese Aufgabe übernehmen und sogar innerhalb der Bezirke mehrere Anlaufstellen existieren. Dies erschwert die Suche nach dem richtigen Ansprechpartner deutlich. Gleichzeitig ist es kaum möglich, das notwendige soziokulturelle Wissen in allen Bezirken flächendeckend zu bringen und bedarfsgerechte Angebote zu machen. Dafür braucht man eine zentrale Anlaufstelle. Schließlich wendet sich Hilbold gegen gesonderte Schutzeinrichtungen, da dies dem Gedanken der Inklusion zuwiderlaufe. Stattdessen kann er sich Schwerpunktunterkünfte vorstellen, die man mit einem neuen Personalschlüssel ausgestattet werden müssen.
In der anschließenden Diskussion interessieren die Teilnehmenden insbesondere der zeitliche Horizont der in Berlin geplanten Maßnahmen und die Einbeziehung von Bezirken, die Möglichkeiten einer engeren bundesweiten Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen sowie die Planungen auf der europäischen Ebene.

So spricht sich der Sprecher der Grünen BAG „Behindertenpolitik“ für die Schaffung von Schutzräumen, die die aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern geflüchteten Menschen mit-organisieren könnten. Hier würden geflüchtete Menschen die Möglichkeit erhalten, sich ohne Scham und Angst über ihre Behinderungen und die damit verbundenen Bedarfe austauschen.

Marianne Freistein von der Fachstelle Migration und Behinderung des AWO Berlin widerspricht den Aussagen von Herrn Hilbold, dass sich geflüchtete Menschen aus kulturellen Gründen zögern, ihre Behinderungen anzugeben. Vielmehr erhalten diese Menschen in der Praxis monate- oder gar jahrelang keine bedarfsgerechten Versorgungsleistungen und Beratung, auch wenn sie pro-aktiv danach suchen, so Freistein.
Als Beispiele dafür verweist Freistein auf die ersten Ergebnisse des DRK-Projekt „Bedarfserhebung von Geflüchteten mit Behinderungen“ sowie auf den AWO-Bericht „Geflüchtete Menschen mit Behinderung und deren Angehörige“ . Freistein plädiert daher für gute Informationsangebote über die Leistungsansprüche für geflüchtete Menschen, damit sie die Entscheidung ob sie ihre Behinderung angeben oder nicht bewusst treffen können.
In der ersten Antwortrunde verweist Jian Omar auf den Berliner Doppelhaushalt 2022-23, der die Fluchtbewegung aus der Ukraine berücksichtigt und 650 Mio. Euro für 2022 sowie ca. 640 Mio. für 2023 eingeplant hat. Da die Lage dynamisch bleibt, wurde ein Sondertopf in einem Einzelplan bei der Senatsverwaltung für Finanzen geschaffen, um die Träger flexibel unterstützen und die Mittel ggf. schnell aufstocken zu können, so Omar. Weiterhin erwähnt Omar das Angebot vom Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen (BNS) vom Frühjahr 2022, Schulungen zur Identifizierung von sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen für das Personal in Tegel durchzuführen, das bis heute jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Omar bezieht sich auch auf die Frage aus dem Publikum nach einer finanziellen Entschädigung für ehrenamtliche Helfer*innen als Privatpersonen. Dies sei laut Omar aus rechtlichen Gründen so nicht realisierbar. Eingetragene Vereine hingegen könnten einen finanziellen Ausgleich in Anspruch nehmen bzw. Fördermittel beantragen.
Erik Marquardt berichtet dazu, dass ein europäischer Schwerbehindertenausweis (EU disability card) bereits seit 2016 in der Entwicklungs– und Erprobungsphase sei ebenso die bilaterale Anerkennung zwischen den Mitgliedsstaaten. Voraussichtlich im November 2023 soll ein EU-Behindertenausweis eingeführt werden.
Tatjana Grabienski geht auf die Notwendigkeit von bedarfsgerechten Flüchtlingsunterkünften ein, die keineswegs mit „Sonderunterkünften“ gleichsetzt werden sollen. Berlin braucht ein bis zwei solche Unterkünfte, wo auch medizinische Behandlung sichergestellt werden kann. Eine Alternative dazu wäre die entsprechende personelle und bauliche Ausstattung von allen Unterkünften mit umfassender psychologischer und sozialpädagogischer Betreuung und geschultem Sicherheitspersonal, was jedoch in der jetzigen Situation kaum realisierbar sei.
Michael Hilbold nimmt Bezug auf den Grabienskis Vorschlag zu bedarfsgerechten Unterkünften und betont, dass hiermit ebenfalls die Sicht der zuständigen Senatsverwaltung abgebildet ist. Gleichzeitig sollte man mit den Begrifflichkeiten achtsam umgehen, um keine „Sonderwelten“ zu schaffen. Bereits jetzt bietet das Land Berlin Schwerpunkt-Unterkünfte für geflüchtete Menschen, beispielweise für LGBTI-Personen, für Frauen sowie für Care Leavers, d.h. für ehemalige minderjährige geflüchtete Menschen, die auch nach ihrem achtzehnten Geburtstag weiterhin Betreuung benötigen und nicht plötzlich auf sich alleine gestellt werden sollen. Zum zeitlichen Horizont erläutert Hilbold, dass bereits im Dezember 2022 weitere Gespräche mit Vertreter*innen der Zivilgesellschaft stattfinden, um die Bedarfsidentifizierung umzusetzen. Dafür müsse man „Systematik“ einbringen, um die erhobenen Bedarfe bearbeiten zu können, was mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Wenn die Qualität und die Quantität der Leistungsansprüche festgestellt ist, stößt man im zweiten Schritte auf „rechtliche Hürden“ bei der Leistungsgewährung. Daher müssen diese beiden Verfahrensschritte aufgrund der dynamischen Lage parallel erarbeitet werden.
Für die Umsetzung des dritten Schrittes – der Einführung einer zentralen Anlaufstelle – stellt die zweistufige Verwaltung in Berlin eine Herausforderung dar. In der Diskussion wird deutlich, dass in den Bezirken Fachkräfte fehlen, die sich der Fragen rund um Flucht und Behinderungen annehmen können, so dass auch die Bezirke die Zentralisierung befürworten. Als Zwischenstufe stellt Hilbold das sogenannte „Clearing-Zentrum“ vor, das im ersten Quartal 2023 in Berlin eröffnet werden soll. Das Clearing-Zentrum soll dafür da sein, „alle nach Berlin verteilten Menschen nach vorherigem Screening und Bestätigung des Befundes in diesen Prozess aller Vorbereitungsmaßnahmen zu einer Leistungsgewährung zu führen“. Um die Leistungsgewährung anschließend durchzuführen, müssen „ein paar Zuständigkeiten im AZG“ verschoben werden. Erschwerend kommt die Inkompatibilität der Systeme in Deutschland und der Ukraine hinzu, so dass man ärztliche Gutachten u.a. braucht, um z.B. das Pflegegrad und das Grad der Behinderung festzustellen. Zusammengefasst soll im Clearing-Zentrum zum einen die medizinische und pflegerische Erstversorgung stattfinden. Zum anderen soll das Clearing-Zentrum Netzwerke aufbauen, um die fachliche medizinische Versorgung zu koordinieren. Das Ziel ist, „die bestehenden Strukturen“ zu ermächtigen und in die Lage zu versetzen, die Leistungen zu gewährleisten, statt Doppelstrukturen aufzubauen. Schließlich soll das Clearing-Zentrum zum Ort werden, wo die Betroffenen umfassende Informationen über die möglichen Leistungsansprüche erhalten. Das Motto von Michael Hilbold lautet: „Gemeinsam geht‘s!“
Alevtyna Nikolchenko, Mutter von zwei behinderten Kindern im Rollstuhl, berichtet von ihrer Erfahrung auf der Flucht aus der Ukraine und nach dem Ankommen in Deutschland. Sie verweist auf das Problem der fehlenden Informationen für ukrainische Geflüchtete mit Behinderungen, z.B. wie man einen Behindertenparkplatz oder einen Rollstuhl erhält. Zum Glück kann sie sich auf die Hilfe von Ehrenamtlichen verlassen und selbst nach Informationen suchen.

Am Anfang wendete sie sich – wie viele anderen Ukrainer*innen – an die Freiwilligen am Infostand am Berliner Hauptbahnhof, der jedoch nicht mehr da ist. Nikolchenko erzählt auch von vielen hilfsbereiten Deutschen, denen sie vom Herzen dankbar ist, z.B. von Mitarbeiter*innen beim Sozialamt, denen jedoch ebenfalls konkrete Informationen fehlen, um geflüchtete Familien mit Angehörigen mit Behinderungen umfassend zu beraten.
Dr. Anna Mogilatenko von der Initiative Sunflower Care e.V. berichtet von der Arbeit ihres Vereins, der Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine evakuiert und weiter in Deutschland betreut. Sie verweist auf die Problematik der Zuständigkeiten in Berlin, die dazu führt, dass „jedes Bezirksamt die Probleme auf eigene Weise löst bzw. weigert sich sie zu lösen“, so dass der Verein mittlerweile zwischen „guten und bösen Bezirksämtern“ unterscheidet. Das akute Problem aus Sicht von Mogilatenko besteht darin, dass viele Familien mit behinderten Familienmitgliedern eine schnelle Pflegestufenbeurteilung brauchen. Sie schlägt vor, eine vorläufige Einstufung zu ermöglichen, die später gründlich überprüft wird, damit diese Menschen ins Versorgungssystem aufgenommen werden können, statt monatelang in Tegel zu bleiben. Sie zitiert eine Mitarbeiterin aus Tegel: „Bitte, bringt keine Menschen mit Behinderungen nach Tegel. Sie werden hier runtergehen. Tegel ist nur für gesunde Menschen“. Mogilatenko nennt Tegel „intransparent“, weil die Ehrenamtlichen da nicht willkommen seien. Aus ihren direkten Kontakten mit Familien in Tegel berichtet sie, dass die da vorhandenen Sozialdienste oft nicht wissen, „was sie machen können“ um den Familien zu helfen. Ein weiterer Vorschlag ist die Schaffung eines Pools mit behindertengerechten Unterkünften in Berlin, wie in einigen deutschen Städten und Gemeinden bereits der Fall ist. Mogilatenko berichtet auch von einer durch den Sunflower Care e.V. betreute Unterkunft in Berlin für Mütter mit gehbehinderten Kindern, die einander unterstützen und in der Zwischenzeit nach eigener Wohnung suchen. Dies ist ein gutes Beispiel, wie solche bedarfsgerechten Unterkünfte funktionieren können, ohne eine Segregation zu verursachen.

Serhii Lutsenko, Anwalt mit einer Sehbehinderung aus der Ukraine, stellt sich als Mitarbeiter einer Organisation für Anwälte mit Sehbehinderungen aus Kharkiw vor (Kharkiv Blind Lawyers). Er schlägt die Einrichtung einer bundesweiten Hotline für ukrainische Geflüchtete mit Behinderungen vor, wo sie eine entsprechende Beratung bekommen. Insbesondere eine Sehbehinderung für ältere Menschen stelle eine große Hürde dar.
Oleksander Nikulin, einer der Podiumsgäste, spricht sich ausdrücklich für die Schaffung von bedarfsgerechten Unterkünften, weil Menschen, die da Zuflucht finden, nicht nur durch ihre Behinderung definiert werden dürfen. Sie bringen alle unterschiedliche Erfahrungen und Eigenschaften mit, so dass allein aufgrund dessen dies keine Sonderunterkünfte werden. Er appelliert an die politischen Entscheidungsträger, alle Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, in einem direkten Austausch mit Selbstvertretungsorganisationen zu treffen, um nicht über ihre Köpfe zu entscheiden.

Elena Levina vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband bezieht sich auf die Ausführungen des ukrainischen Anwalts Serhii Lutsenko und listet die aktuellen Herausforderungen auf. Sie berichtet von der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Blinden- und Sehbehindertenorganisationen sowie mit EUTB. Die Regelungen zur Leistungsversorgung unterscheiden sich stark vom Bundesland zum Bundesland. Der Umzug in ein anderes Bundesland wird oft zu einer „Mammutaufgabe“. In der ersten akuten Phase konnte sich DBSV e.V. auf viele Freiwillige verlassen. Die evakuierten Gruppen fanden vorübergehend Obhut in Unterkünften, wo jedoch die Frist mittlerweile ausläuft und Menschen dringend eine neue Unterkunft brauchen. Auch die Sprachmittlung ist ein großes Hindernis. Von 180 Personen aus der Datenbank des DBSV haben bis heute lediglich drei Personen einen Schwerbehindertenausweis erhalten.
Jan Schmid aus dem Kreisvorstand der Grünen in Lichtenberg verweist darauf, dass er selbst Autismus hat und sich wohl mit dem Begriff „Behinderung“ fühlt. „Nichts für uns ohne uns!“ – dieses Motto aus der Behindertenbewegung sollte leitend für politische Entscheidungen sein. Außerdem äußert er die Befürchtung, dass die Bedenken gegen Sonderunterkünfte dafür genutzt werden könnten, überhaupt bedarfsgerechte Unterkünfte zu schaffen, was auf jeden Fall vermieden werden soll.
Jian Omar weist auf die Bemühungen des Willkommenszentrums in der Potsdamer Straße 61 hin, das Informationen und Sprechstunden in 13 Sprachen anbieten möchte. Omar betrachtet die dauerhafte Unterbringung in Tegel als kritisch, sieht aber zurzeit keine andere Möglichkeit, als die Erstankunft über Tegel zu organisieren und gleichzeitig die Menschen danach dezentralisiert – z.B. in Hostels – unterzubringen.
Auch das Thema Pflege wurde von den Anwesenden thematisiert. Tatjana Grabienski gibt zu bedenken, dass der Prozess der Beantragung eines Pflegegrads viel Zeit in Anspruch nimmt. Diese Menschen befinden sich in der Zwischenzeit in Regelunterkünften, wo es an Kapazitäten fehlt, z.B. auf die Medikamentengabe zu achten oder bei leichter Demenz, verschiedenen Behinderungen oder psychischen Problemen die Menschen entsprechend zu betreuen. Sie verweist auf Einrichtungen wie die Pflegestützpunkte und das Projekt Brückenbauer*innen sowie auf Integrationslotsen, die diese Aufgaben in der Zwischenzeit übernehmen. BZSL e.V. arbeitet eng mit den Sozialdiensten der Unterkünfte zusammen, die zu betreuende Fälle vermitteln. Die Teilnehmer*innen sind sich darin einig, dass das Verfahren im Fall besonders schutzbedürftiger Geflüchteter vereinfacht werden muss.
Weitere Diskussionspunkte sind der von Antonia Schwarz von der Grünen LAG „Gesundheit und Soziales“ angesprochene Zusammenhang Behinderung und Alter sowie die psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung, die Hilbold zufolge derzeit sehr ausgedünnt ist.
Anschließend berichtet Hilbold von zwei Jugendlichen mit Zerebralparese aus der Ukraine, deren Familien die Kinder in eine stationäre Einrichtung nicht bringen wollten. Stattdessen wurden zwei LAF-Unterkünfte für diese Familien gefunden sowie ambulante Versorgung wie Physiotherapie organisiert. Hilbold spricht sich zum Schluss nochmal für die Zentralisierung der Bedarfsidentifizierung sowie für die Einbeziehung von zivilgesellschaftlicher Expertise aus. Seiner Einschätzung nach braucht man auch in Zukunft Großunterkünfte als Zwischenlösung, die jedoch bedarfsgerechter ausgestaltet werden sollen.

Catrin Wahlen betont abschließend den strukturierten Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren. Sie dankte sowohl den Podiumsgästen als auch den vor Ort und virtuell anwesenden Teilnehmer*innen. Die deutsch-ukrainische Simultanübersetzung wurde dank dem Einsatz der Dolmetscherinnen Olena Bykovets und Ludmila Schnur ermöglicht.
Bei einem informellen Austausch mit Vernetzungsmöglichkeiten für die anwesenden Gäste klang die Veranstaltung aus.